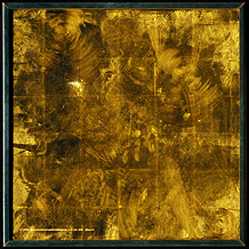1998 Fluchtspuren, Ostbosnien -Steyr
Ich komme aus einem kleinen Dorf in
Ostbosnien, ungefähr zehn Kilometer von der Stadt Foća entfernt. Ich bin
1969 dort geboren. Es war zwar ein rein muslimisches Dorf, in der Umgebung
wohnten aber auch Serben. Mein Vater arbeitete in einer Holzfirma, die Mama
war zu Hause. Wir hatten einen kleinen Bauernhof mit Schafen, Kühen und
Hühnern, dazu einen großen Garten, wo wir Gemüse anbauten.
Die ganze Familie war zusammen, wir
waren glücklich und zufrieden. Ich habe noch eine ältere Schwester und zwei
jüngere Brüder. Ich lebte 25 Jahre in diesem Dorf, und ich kann mich an
keine große Traurigkeit erinnern. Mit der Schule hatten wir keine Probleme.
Meine Schwester ist nach acht Jahren Schule zu einem Onkel in die
Herzegowina gegangen, wo sie drei Jahre im Gymnasium war. Auch ich wollte
weiter in die Schule gehen, aber Papa war dagegen, er meinte, wir könnten es
uns nicht leisten. Aber es fehlte uns an nichts, weil wir das
Lebensnotwendige selber hergestellt haben.
Den Sommer haben wir Kinder mit der
Mutter immer auf einer Alm verbracht, zu Fuß – steil bergauf - war sie vom
Elternhaus in rund 45 Minuten erreichbar. Wir hatten dort eine Hütte. Sie
war ganz einfach eingerichtet, auf einer Steinplatte wurde gekocht und auch
Brot gebacken. Auf dieser Alm haben wir Käse und Butter für unseren Vorrat
erzeugt. Natürlich mußten auch wir Kinder mithelfen. Insgesamt hatten wir
vielleicht fünfzehn Schafe und drei Kühe, da gab es immer viel zu tun.
In der Volksschule gab es serbische und
muslimische Kinder. Natürlich hatten wir auch serbische Freunde, wir sind ja
acht Jahre zusammen in die Schule gegangen. Wir haben manchmal gestritten,
uns aber am nächsten Tag wieder versöhnt. Daß so etwas Schreckliches
passieren könnte, habe ich nie gedacht.
Nur meine Oma hat oft vom Krieg
erzählt, mein Vater, Jahrgang 1941, war dazu noch zu jung. Sie hat uns immer
davor gewarnt, Brot wegzuwerfen. Sie sagte: ”Ihr wißt nicht, was Hunger
ist.” Aber wir Kinder haben das nie verstanden. Der Opa hat einmal einen
ganzen Winter in einer Höhle versteckt gelebt, weil er Angst vor den
Tschetniks hatte. Sein ältester Sohn, mein Onkel, war nämlich bei den
Partisanen. Die Oma war allein mit ihren acht Kindern zu Hause. Da ist
einmal ein Tschetnik ins Haus gekommen und wollte alle mit einem Messer
töten. Doch der Nachbar, der Bruder des Tschetniks, hat ihn gewarnt: ”Tu es
nicht, sonst werde ich dich töten!” Er hat es dann nicht getan.
Sicher sind nicht alle Serben schlecht.
In der Volksschule hatten wir zwei serbische Lehrer. Der eine, mein Lehrer,
hat die Kinder geschlagen, der andere, zu dem meine Geschwister am
Nachmittag gingen, war ganz anders, er war freundlich und hat gut
unterrichtet. Wenn man für meinen Lehrer etwas getan hat, z.B. seine
Schweine füttern, oder wenn der Papa ihm ein Bier bezahlt hat, hat es gute
Noten gegeben. Er war total ungerecht und ein starker Nationalist. Aber
unsere Eltern wollten keinen Streit mit ihm, auch nicht, als ich einmal mit
blutender Nase und einem blutverschmierten Buch nach Hause gekommen bin.
Tito haben wir alle geliebt. In der
Schule haben wir nur Positives über ihn gehört. Als er gestorben ist, hat
Papa geweint. Schon in meiner Kindheit hieß es, daß es Krieg geben werde,
wenn Tito einmal stirbt. Alle hatten Angst davor, warum, weiß ich erst
jetzt. Damals wurde gesagt: ”Die Tschetniks werden wiederkommen”. Die alten
Leute wußten, wovon sie sprachen. Meine Mama hat eine Tante gehabt, die im
2. Weltkrieg viel mitgemacht hat. Sie hat die Kinder und den Mann verloren,
ich weiß nicht, ob sie nicht auch vergewaltigt wurde. Die hat jedenfalls die
Serben nie gegrüßt.
Auch die Lehrer in der Hauptschule
waren in erster Linie Serben, die Kinder gemischt. Ich habe sehr gut
gelernt, aber vor allem mein Klassenvorstand hat mir immer schlechtere Noten
gegeben. Ich wußte nicht, warum. Er unterrichtete Russisch, und ich haßte
diese Sprache. Ich glaube, ich kann mich nur mehr an zwei, drei russische
Worte erinnern. Viele Lehrer waren eben nationalistisch eingestellt, aber
damals hatte ich keine Ahnung davon. Ich verstand den Unterschied zwischen
Serben und Moslems nicht. Ich wußte, daß die Serben Schweine hatten, wir
aber nicht, weil wir kein Schweinefleisch essen durften. Auch da war mir
nicht klar, warum. Ich dachte, wir wären alle gleich. Ich habe einmal mit
einem serbischen Kind geschimpft und dabei unseren Gott ”Allah” erwähnt. Das
Mädchen hat gefragt: ”Was hast du gesagt?” Da wurde mir erst klar, daß sie
nicht so sind wie wir.
Die serbischen Nachbarn waren bei uns
eingeladen, und wir sind zu ihnen gegangen. Das war normal. Ich war als Kind
fast öfter bei der serbischen Nachbarin als zu Hause. Ich habe sie so
geliebt und habe oft dort geschlafen. Die Frau war für mich wie eine Mutter.
Ich erinnere mich, wie gern ich ihr frisch gebackenes Brot gegessen habe.
Ihr Sohn hat mir später geholfen, zu flüchten. Als ich das letzte Mal mit
ihr gesprochen habe, Anfang Juli 1992, hat sie gemeint: ”Du weißt, du kannst
immer kommen, so wie meine Tochter.” Wir weinten beim Abschied, aber sie hat
mir nicht gesagt, daß die Tschetniks in zwei Tagen kommen werden. Ich
glaube, sie hat es gewußt. An diesem Tag sind nämlich alle Serben aus ihren
Häusern verschwunden.
Die Religion hatte für uns, mit
Ausnahme meiner Oma, keine Bedeutung. Es gab auch keine Moschee im Dorf.
Mein Vater war Kommunist. Wenn er etwas getrunken hatte, konnte er sehr böse
werden, sonst war er gut zu uns. Die meisten Männer waren so, jeden Tag nach
der Arbeit trafen sie sich, und dann kamen sie betrunken nach Hause. Ich
erinnere mich, daß mein Vater mich zwei- oder dreimal geschlagen hat, als
ich nicht lernen wollte. Früher hat er in diesem Zustand oft meine Mama
beschimpft, sie hat dann geweint und wir auch. Für uns Kinder war es
manchmal wirklich schlimm. Die Mama war ja eine so gute Frau. Mit vierzehn
oder fünfzehn Jahren hat sie ihn geheiratet, das war damals so üblich. Es
war nicht leicht für sie, trotzdem war sie irgendwie zufrieden. Natürlich
mußten wir Kinder viel arbeiten, vor allem der Mama helfen, weil der Papa
nie da war. Wir holten Brennholz aus dem Wald, und es gab noch viele andere
Aufgaben.
Ich war in der 6. oder 7.Klasse, als Tito gestorben ist. Wir
waren alle sehr traurig, ich erinnere mich noch genau, wie wir vor seinem
Bild gestanden sind. Die Leute waren irgendwie eigenartig ruhig und hatten
Angst. Alle sagten: „Jetzt kommt Krieg!“ Da habe ich gedacht, die Deutschen
kämen wieder oder die Tschetniks - ich hatte damals von diesen Dingen
absolut keine Ahnung.
Nach der Schule war ich zwei oder drei
Jahre zu Hause. Gerne hätte ich einen Beruf erlernt, am liebsten
Schneiderin, aber mein jüngerer Bruder machte eine Ausbildung zum Piloten,
und Papa mußte ihm das Internat zahlen. Außerdem haben wir damals das Haus
vergrößert, da war für mich kein Geld übrig. Später habe ich Papa deshalb
Vorwürfe gemacht. Wenn man keine Schulbildung hat, ist man immer unten, und
jeder kann dir anschaffen, was du tun sollst. Mit achtzehn Jahren bin ich
als Putzfrau in diese große Firma gegangen, in der auch Papa gearbeitet hat.
Wie überall üblich hatte die Firma zwei Chefs, einen Serben und einen
Moslem. Papa war Schichtarbeiter, später hat er es bis zum Vorarbeiter
gebracht. Ich war nicht besonders zufrieden, trotzdem war ich sieben Jahre
dort, bis zum Krieg. Damals habe ich natürlich zu Hause gewohnt, bei uns
kann man nämlich nicht mit achtzehn Jahren weggehen: Erst wenn man heiratet,
geht man von zu Hause weg.
An Freitagen bin ich manchmal nach Foca
einkaufen gefahren. Foca war eine schöne kleine Stadt. Es gab eine Altstadt
mit einem starken orientalischen Einschlag. Von den zwölf Moscheen der Stadt
- eine war fast fünfhundert Jahre alt - steht heute keine mehr, sie wurden
alle im Krieg zerstört. An ihrer Stelle gibt es heute Parkplätze. Ich weiß
nicht, warum der Haß so groß war. Ich wußte früher gar nicht, was Haß ist,
aber heute weiß ich: Ich muß hassen, weil ich so schrecklichen Dinge erlebt
habe.
Ich hatte viele Freunde in der Firma,
im Dorf, auch in Foća. Wir haben uns immer am Abend getroffen, oft haben wir
ein Feuer gemacht und Musik gehört. Jeden Tag war Musik im Dorf, bei Festen
wurde viel gesungen und musiziert, besonders bei Hochzeiten. Als mein Bruder
zum Militär ging, haben wir zwei Tage lang gefeiert. Es wurde ein Schaf
gegrillt, und alle kamen, natürlich auch die serbischen Nachbarn.
1990 ist der große Bruder nach
Österreich gegangen, nach Steyr. Sein Schwiegervater hat ihn dorthin
vermittelt. Er hat uns manchmal besucht. Jetzt arbeitet er schon über
zwanzig Jahre in Österreich.
Die wirtschaftliche Lage in Jugoslawien
verschlechterte sich, zwei Jahre lang bekamen wir Gutscheine statt unserer
Löhne. Es gab zwei oder drei Geschäfte, wo man Lebensmittel kaufen konnte,
aber man mußte immer aufpassen, wenn etwas kam, und dann schnell zuschlagen.
Von Steyr hatte ich damals die Vorstellung einer wunderschönen Stadt, in der
alle Bewohner unheimlich reich sein mußten. Wir waren sehr beeindruckt, wenn
Leute, die in Österreich gearbeitet haben, plötzlich mit einem schönen
großen Auto aufgetaucht sind. Eines Tages kam der Schwiegervater meines
Bruders mit einem großen Lancia und brachte eine neue Waschmaschine,
die der Bruder für uns in Steyr gekauft hatte. Das war schon eine tolle
Sache, aber ich habe meinem Bruder nie gebeten, mich mitzunehmen. Ich war
zufrieden mit meiner Arbeit und mit dem, was wir hier hatten.
Damals habe ich auch einen Freund
gehabt. Er mußte zum Militär und war in Sarajevo stationiert. Trotzdem hat
er mich oft besucht, wir haben uns auch regelmäßig geschrieben. Dann hat er
sich entschieden, nach Libyen zu gehen. Das hat mich sehr gekränkt, und als
wir uns verabschiedeten, habe ich eigentlich nur mit ihm geschimpft. Im
nachhinein hat mir das sehr leid getan. Kurz vor dem Krieg ist er dann
zurückgekommen. Wir wollten heiraten, aber der Krieg hat alles zunichte
gemacht. Nach dem Krieg habe ich ihn dann überall gesucht und schließlich
auch gefunden. Aber es funktioniert nicht mehr, er trinkt und ist so anders
geworden - durch diesen verdammten Krieg. Es war ein Schock für mich, als
ich ihn das erste Mal wiedergesehen habe. Ich empfand nur mehr Abscheu und
Ekel. Den Alkohol hab ich schon bei meinem Vater kennen und hassen gelernt,
ich wollte das nicht noch einmal erleben.
In der Firma hat man damals gespürt,
daß sich die Situation zwischen Moslems und Serben zuspitzt. Es wurden neue
Parteien gegründet, es gab Provokationen und Demonstrationen. Im Dorf selbst
war es ruhig. Die wichtigsten Informationsquellen waren damals das Radio und
die Gespräche mit meinen Kollegen in der Firma. Ich habe Angst gehabt, aber
nicht wirklich geglaubt, daß es einen Krieg geben könnte.
An einem Montag im April 1992, der
erste Arbeitstag nach einem hohen moslemischen Feiertag, kam ich in die
Firma und stellte fest, daß – bis auf den Chef - alle serbischen Kollegen
verschwunden waren. Wir tranken gerade Kaffee, als unser Chef zur Tür
hereinkam und sagte: ”Wir machen Schluß für heute”. Irgend etwas mußte
passiert sein.
Ich fuhr mit meiner Cousine und einem
Arbeitskollegen aus einem Nachbardorf nach Foća. Dort war alles in Aufruhr.
Viele Autos waren unterwegs, und die Straßen waren voller Menschen. Die
Serben waren offensichtlich dabei, die Stadt zu verlassen, und die Moslems
demonstrierten: ”Wir wollen Frieden und nicht Krieg”. Ein Kollege meinte:
”Jetzt ist es soweit, jetzt wird es ernst”. Als ich zu Hause ankam, fragte
meine Mutter ganz aufgeregt: ”Wo warst du? Was ist mit dir passiert? Weißt
du denn nicht, was los ist? Der Krieg ist ausgebrochen!” Ich konnte das
alles einfach nicht glauben.
Am nächsten Tag wollte ich ins untere
Dorf einkaufen gehen, da kam mir mein Cousin entgegen: ”Geh weg! Ganz Foca
steht unter Feuer! Die Tschetniks beschießen die Stadt! Geh sofort zurück!"
Überall, auch im Dorf, standen plötzlich uniformierte Soldaten herum. Nein,
es war kein fremdes Militär, es waren unsere serbischen Nachbarn! Es war
einfach nicht zu begreifen, sie haben sich schnell die Uniformen angezogen
und die Kontrolle übernommen!
Ab diesem Zeitpunkt hatten wir große
Angst. Wir trauten uns nicht mehr, die Nächte in unseren Häusern zu
verbringen, also schliefen wir im Wald. Wir hatten uns ungefähr zwei
Kilometer vom Dorf entfernt eine Art Versteck gebaut, das nur die Frauen am
Tag verließen, um Essen zu kochen und die Tiere zu füttern. Wir hatten
damals noch eine Kuh und einen Stier im Stall, auch der Garten mußte betreut
werden. Der war schön wie nie zuvor, alles ist so prächtig gewachsen! Im
Dorf selbst gab es noch keine Schießereien, aber aus der Entfernung hörten
wir oft Schüsse und sahen brennende Häuser. Das Leben in diesem Versteck, in
dem wir fast drei Monate – bis zum Juli1992 – verbrachten, war manchmal fast
nicht mehr zu ertragen, besonders dann, wenn es kalt war. Und es war in
diesem Jahr oft entsetzlich kalt, es gab viel Regen und sogar noch Schnee.
Meine Cousine hat damals ihr Kind bekommen, auch sie hat die ganze Zeit mit
uns im Wald gelebt.
Natürlich haben wir oft über eine
Flucht nachgedacht. Weil unser Dorf von den Tschetniks so gut wie
eingekreist war, konnten wir nur über die Berge entkommen. Ich wollte
unbedingt mit meinem Bruder weg, ich wußte, sie würden ihn sonst umbringen.
Viele wollten aber wegen der Häuser und der Tiere nicht weggehen. Wir
konnten uns einfach nicht einigen. Für mich kam eine gemeinsame Flucht nicht
in Frage, wir waren ja insgesamt ungefähr sechzig Leute, und es waren alte
Leute und Kinder darunter, die nicht schnell laufen konnten. Ich hatte Angst
und dachte, als Gruppe würden sie uns sicher erwischen. Dazu kam noch etwas
anderes: Die serbischen Milizen, die jetzt unser Dorf kontrollierten, hatten
uns gesagt, wenn wir alle unsere Waffen abgeben, werden wir keine Probleme
haben. Unsere Männer hatten Jagdgewehre, außerdem waren zwei oder drei von
ihnen früher bei der Polizei gewesen und besaßen daher Pistolen. Eines Tages
haben sie aber wirklich alle Waffen abgegeben in der Hoffnung, daß alles
wieder gut wird. So waren es vor allem die Männer, die bleiben wollten. Es
ging sogar so weit, daß einer gemeint hat, wenn ich gehe, dann würde er das
den Tschetniks melden. Er hatte große Angst, daß wir auf der Flucht
verhungern würden, deshalb hat er uns so unter Druck gesetzt.
Tragischerweise war er später der erste, der mit seinen beiden Söhnen von
den Tschetniks getötet wurde.
Heute weiß ich, daß es damals nachts
sicher möglich gewesen wäre, zu flüchten. Die Stellungen unserer bosnischen
Soldaten waren nur einige Stunden von uns entfernt.
Anstatt zu fliehen, gruben unsere
Männer Höhlen für noch bessere Verstecke. Aber durch das Radio haben wir
erfahren, was los war. Eigentlich war uns allen ganz klar, daß die
Tschetniks kommen werden, und so haben wir nichts Besseres zu tun gehabt,
als auf sie zu warten.
Es war am 3. Juli 1992, um halb 7 Uhr früh, da haben uns
plötzlich Schüsse in nächster Nähe aus dem Schlaf gerissen. Sofort habe ich
gedacht: Jetzt sind sie da. Ich springe auf, nehme meine Schuhe und laufe so
schnell ich kann den Berg hinauf. Mit mir mein Bruder, meine Cousine, mein
Papa und meine Mama. Der Hang ist sehr steil, wir laufen um unser Leben. Die
Kugeln pfeifen uns um die Ohren, die Tschetniks feuern mit ihren
Maschinengewehren wahllos hinter uns her. Der Nebel hindert sie am genauen
Zielen. Wahrscheinlich sind es die Sachen, die die Frauen im Laufen
fallenlassen und unsere Spuren, die ihnen den Weg weisen. Ich bin schneller
als die anderen, aber plötzlich kann ich nicht mehr laufen. Mein Gott, ich
habe solche Angst, daß sie meine Füße kaputtschießen! Ich setze mich einfach
hin und warte. Von unten kommen die anderen Frauen mit ihren Kindern. Mein
Papa läuft an mir vorbei, meine Mama ist noch hinten, und weiter unten
wartet mein Bruder auf Oma und Opa. Sie können nicht mehr so recht
mithalten, trotzdem will er die beiden nicht allein lassen. Da kommt
plötzlich eine Frau herauf, schreiend und völlig verzweifelt. Sie hat
gesehen, wie sie ihren Mann erschossen haben. Zur gleichen Zeit hat es meine
Mama bis zu mir herauf geschafft, aber sie sagt: ”Ich kann nicht mehr. Ich
bin so kaputt. Ich kann nicht mehr.” Ich sage zu ihr: ”Leg dich nieder und
warte, bis es wieder ruhig ist.” Da sieht sie meinen Bruder, sie steht auf
und will ihm etwas sagen. Ein Projektil schlägt direkt in den Baum ein,
hinter dem ich stehe, eine Frau reißt mich zu Boden. In diesem Augenblick
sehe ich, wie meine Mutter, von einem Schuß in den Kopf getroffen, rücklings
zu Boden stürzt. Ihre Haare und ihr Gesicht sind voller Blut. Ich will sie
nehmen und mit ihr weiter laufen, aber die Frau neben mir schreit: ”Nein, tu
das nicht, sonst bist du auch tot!” So bin ich bei meiner Mama geblieben.
Die Szenen, die sich um uns herum abspielten, waren fürchterlich:
Schwerverletzte lagen auf dem Boden, Kinder, deren Mütter getroffen waren,
weinten, es war das totale Chaos.
Da hat ein Mann aus unserer Gruppe zu
schreien begonnen: ”Bitte, schießt nicht mehr! Wir warten, egal was
passiert, wir warten. Alle sind tot, auch Kinder sind dabei.” Aber die
Tschetniks, die plötzlich auftauchten, haben nur geflucht und uns
beschimpft. Zum erstenmal habe ich gesehen, wie sie aussahen: fünf oder
sechs haßerfüllte Typen, voll bepackt mit Munition, Kalaschnikows und
Handgranaten. Sofort haben sie begonnen, die Männer zu schlagen und zu
mißhandeln. Viele waren verletzt, mein Bruder hatte einen Bauchdurchschuß
und meine Oma ein Loch in ihrer Hand. Auch uns Frauen haben sie geschlagen
und fürchterlich beschimpft.
Ich habe sie alle gekannt, es waren
serbische Männer aus den umliegenden Dörfern. Der eine war zum Beispiel ein
Kollege meines Bruders, mit dem er in die Schule gegangen ist. Sie haben
geschrien: ”Wo ist denn euer Itzetbegović? Warum hilft er euch jetzt nicht?”
Dann trieben sie uns hinunter auf eine Waldlichtung, dabei sangen sie ihre
typischen Tschetnik-Lieder. Unten angekommen, mußten wir uns alle der Reihe
nach aufstellen, links die Frauen und Kinder, rechts, ein Stück weiter weg,
die Männer. Insgesamt waren es sieben Männer - wir haben sie damals das
letzte Mal gesehen. Einer von ihnen war mein Bruder. Eigentlich wollte ich
mit ihm reden, wollte ihn fragen wie es ihm geht, aber ich hatte solche
Angst, ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ich habe so viel Zeit
mit ihm verbracht, und wir haben uns immer so gut verstanden. Ihn habe ich
wirklich geliebt. Der Gedanke, daß ich nicht mehr mit ihm reden konnte,
verfolgt mich noch heute.
Wir Frauen und Kinder mußten
weitergehen, die Männer blieben dort. Ich habe mich nur kurz umgedreht, aber
nichts mehr gesagt. Auf dem Weg hat mich ein Tschetnik aus irgendeinem
nichtigen Grund plötzlich an den Haaren gezogen, brutal zu Boden gerissen
und mit den Füßen getreten. Immer wieder haben sie einen Vorwand gesucht,
uns zu schlagen. Trotzdem habe ich mir von Anfang an gesagt: Du wirst nicht
sterben. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf vorging.
Die Tschetniks haben uns durch unser
Dorf getrieben und ich sah, daß alle Häuser abgebrannt und zerstört waren.
Plötzlich hörten wir eine Maschinengewehrsalve und ich wußte sofort, jetzt
haben sie unsere Männer umgebracht. Ich hatte ja schon gehört, was in
anderen Dörfern passiert war. In einem Dorf wurden alle Bewohner umgebracht.
In erster Linie ging es ihnen darum, die Männer zu beseitigen
Wir wurden in ein Motel in der Nähe
unseres Dorfes gebracht, das man früher als Kinderferienheim verwendet
hatte. Dort wimmelte es nur so von schwer bewaffneten Tschetniks aus den
umliegenden Dörfern, aber auch aus Serbien und Montenegro.
Einer von ihnen kam zu mir und sagte: ”Du kommst mit.” Wir
gingen in einen Raum , wo drei Männer saßen, die ich alle kannte. Der eine
sagte: ”Wenn du alles sagst, wird dir nichts passieren, aber wenn du lügst,
werden wir dich alle vergewaltigen.” Dann habe ich erzählen müssen, wer
aller im Dorf wohnte, von den Kindern bis zu den Männern. Er hat alles
aufgeschrieben. Ich habe alle aufgezählt, aber meinen Vater habe ich einfach
vergessen. Da hat er mich gefragt: ”Wo ist dein Vater?” Ich habe gesagt:
”Ich weiß nicht, ich glaube, er ist tot.” Dann wurde ich in einen anderen
Raum gebracht, wo viele Tschetniks waren. Ein etwa Fünfzigjähriger kam auf
mich zu und sagte, er werde jetzt mit mir schlafen. Aber ich sah genau, wie
viele noch darauf warteten. Ich wollte mich wehren, doch ich war wie
gelähmt. Und dann habe ich gesagt: ”Tun Sie, was Sie wollen.” Ich habe nur
bis zum zehnten mitgezählt. Ich konnte nicht mehr, ich war ganz kaputt. Von
nebenan habe ich das Wimmern meines Onkels gehört. Sie haben ihn geschlagen.
Plötzlich hörte ich einen Schuß. Später habe ich erfahren, daß sie ihn in
die Drina geworfen haben, die dort ganz in der Nähe vorbeifließt.
Mir war fürchterlich kalt. Ich wollte
mich anziehen, aber ich durfte nicht. Ich wollte auf die Toilette gehen, sie
erlaubten es nicht. Vor der Tür saßen drei Tschetniks in Zivil. Nachdem sie
Wasser auf mich geschüttet hatten, sagte einer von ihnen: ”Zieh dich an und
geh hinaus. Draußen wartet der Bus auf dich.” Ich glaubte es nicht, ich
dachte: Die sind mit mir fertig, jetzt erschießen sie mich und werfen mich
in den Fluß. Ich konnte einfach nicht weinen, der Schock war zu groß. Ich
konnte auch nicht gehen, zwei Männer mußten mich stützen. Aber da war
wirklich ein Bus. Er war voller Männer, einige waren gerade dabei, ein
Mädchen zu vergewaltigen. Vor dem Bus weinte die Mutter des Mädchens, sie
bat einen Tschetnik, ihr doch ihr Kind zurückgeben, es sei erst vierzehn
Jahre alt. Dann sind andere Frauen und Kinder gekommen, darunter auch meine
Oma, und wir sind alle zusammen nach Foca gefahren. Sie brachten uns zur
Polizeistation. Wir warteten lange im Bus, sie wußten nicht, was sie mit uns
anfangen sollten. Bis zu diesem Zeitpunkt erlebte ich alles wie einen bösen
Traum, ich war vor Angst wie gelähmt und konnte nicht reagieren. Auf einmal
fühlte ich mich so schwer, ich konnte nur noch weinen. Ich hatte Mamas Bild
vor Augen, und mir wurde plötzlich bewußt, was alles passiert war.
Sie brachten uns in eine Schule, in
einen Raum mit Matratzen und Decken. Ich war so fertig, ich habe sicher
tage- und nächtelang nur geweint. Jeden Abend kamen die Tschetniks und
holten uns, die jungen Frauen und Mädchen. Sie sagten etwas von Wohnung
putzen oder so, aber jedes Mal wartete eine Gruppe Tschetniks auf uns, um
uns zu vergewaltigen. Wir blieben dort zwölf Tage, aber ich glaube, ich habe
nur zwei Nächte wirklich geschlafen. Einmal mußten wir vor den laufenden
Kameras einer serbischen Fernsehstation sagen, wie schön es hier sei, daß
wir dreimal am Tag zu essen bekämen und wie gut wir untergebracht seien. Ich
schaute nur auf den Boden und habe den Reporter nicht einmal angesehen. Nach
zwei Tagen kamen wir in ein anderes Quartier, in ein ganz desolates Gebäude.
Es gab kein warmes Wasser, statt auf Matratzen lagen wir auf Sportmatten.
Wir mußten uns mit unseren Pullovern und Jacken zudecken. Meine Cousine und
ich hatten zwei Kinder bei uns, deren Mutter getötet worden war. Das Mädchen
war drei, der Bub zwölf Jahre alt. Die Kinder haben genau begriffen, was
vorging. Meine Cousine hat das Mädchen immer festgehalten, und wenn die
Tschetniks am Abend kamen, haben die Kinder zu weinen begonnen. Manchmal
haben sie dann gesagt: ”Laßt die mit dem Kind. Nehmt euch eine andere.”
Einmal hat der Bruder seine Schwester gezwickt, damit sie weinen mußte. Die
Kinder wollten uns schützen, vor allem meine Cousine, denn sie hat sehr viel
für sie getan.
Dieses Lager war fürchterlich, wir
hatten keine Ruhe, immer wieder holten sie uns, brachten uns in ein Haus
neben dem Lager und vergewaltigten uns. Wenn wir uns geweigert oder gewehrt
haben, haben sie uns geschlagen oder gedroht, uns umzubringen. Einmal wollte
mir jemand eine Handgranate geben, er meinte: ”Damit kannst du dich in die
Luft jagen, wenn es noch schlimmer wird.” Ich hab sie nicht genommen. Egal
was passierte - ich wollte nicht sterben.
Eines Morgens, es war ungefähr vier
Uhr, befahlen sie uns, in ein Auto zu steigen. Sie brachten uns in ein Dorf,
zwanzig Kilometer außerhalb von Foca. Wir sollten zum Anführer einer als
besonders brutal und grausam geltenden Tschetnik-Bande gebracht werden.
Erste Station war ein Gasthaus, offensichtlich das Hauptquartier der Bande.
Der Raum war voll mit diesen
betrunkenen Typen, auf den Tischen standen überall Bierflaschen und Essen
lag herum. Sie zwangen uns, etwas zu essen, aber ich konnte einfach nicht,
ich war so kaputt. Da kam einer und sagte zum Kommandanten: ”Die da ist
sowieso schon so gut wie tot, soll ich mit ihr hinausgehen und sie
erschießen?"
Wir wurden in ein Haus in der Nähe von
diesem Gasthaus gebracht. Es gehörte einem Moslem, der über zwanzig Jahre in
Deutschland gearbeitet hatte. Die Tschetniks haben es einfach genommen. Der
Besitzer war schon mit seiner Familie geflüchtet, nur eine Tochter blieb
zurück. Auch sie wurde vergewaltigt, konnte aber später entkommen. Ich hatte
nie zuvor ein so schönes Haus gesehen, vom Dachboden bis zum Keller voll mit
schönen Sachen. In diesem Haus blieben wir drei Monate. Zuerst waren wir
neun, später acht Mädchen. Tagtäglich wurden wir gezwungen, mit diesen Typen
zu schlafen, wir hatten keine andere Wahl. Daneben mußten wir für sie das
Frühstück machen, ihnen die Wäsche waschen und natürlich das Haus sauber
halten. Am Tag waren wir meistens allein im Haus, aber es gab keine
Fluchtmöglichkeit. Außer uns gab es keine Moslems mehr in der Stadt, wir
waren allein inmitten von lauter Serben. In dieser Zeit redeten wir viel
miteinander, ich war die älteste von uns.
Eines Tages fanden nicht weit von
unserem Haus entfernt große Kämpfe statt. Da wußten wir, daß unsere Leute
(die bosnischen Soldaten) in der Nähe waren. Also zogen wir unsere Schuhe
und Mäntel an und machten uns bereit zum Aufbruch. Wir wollten verschwinden,
aber keiner wußte, wohin wir eigentlich gehen sollten. Neben unserem Haus
war zwar ein Wald, aber wir hatten solche Angst, daß mich die Tschetniks
dort erwischen und erschießen würden; also blieben wir.
Eine Achtzehnjährige und eine
Vierzehnjährige waren für die zwei Kommandanten reserviert, der Rest mußte
für alle anderen da sein. Die Jüngste von uns war zwölf, sie wurde direkt
aus der Wohnung ihrer Mutter weggeholt und zu uns gebracht. Auch wenn es
wirklich schlimm war, irgendwie hatte ich immer einen großen Optimismus. Er
hat mich am Leben erhalten. Wenn wir allein waren, sagte ich oft zu den
Mädchen, eigentlich waren es Kinder für mich: ”Paßt auf, wir müssen
durchhalten. Wir kommen sicher da heraus. Wir gehen zusammen nach
Österreich, dort ist mein Bruder, dort ist es schön.” Manchmal saßen wir
zusammen, tranken Kaffee und hörten Radio Sarajevo, das hat uns Hoffnung
gemacht. Oft hatten wir aber wieder so eine Wut, da nahmen wir alles, was
uns unterkam und warfen es gegen die Wand.
Die meisten Männer kamen immer wieder,
ich notierte mir ihre Namen und woher sie kamen. Ich erinnere mich nur an
ganz wenige, die sich einigermaßen menschlich benahmen. Im ersten Lager war
ein Tschetnik mit einem Freund aufgetaucht. Er stand in der Tür und sagte:
”Du, komm her, hab keine Angst – ich will nichts von dir!” Ich hatte
tatsächlich große Angst, aber er hat mir eine Tafel Schokolade gegeben und
mich wirklich nicht angerührt. Diesen Mann habe ich sieben Monate später in
Foca wieder getroffen.
Nach drei Monaten in diesem Haus wurde
ich mit drei anderen Mädchen, darunter meine Cousine, an eine weitere
Tschetnik-Gruppe mit einem anderen Kommandanten übergeben. Es war bereits
die dritte Gruppe, mit der wir zu tun hatten. Man brachte uns wieder in eine
Wohnung in Foca zurück. Der Kommandant war übrigens derselbe, der mich nach
meiner Verhaftung in unserem Dorf verhört hatte. Er nahm sich unsere
Jüngste, die Zwölfjährige, und er hat sie in dieser Nacht vergewaltigt.
Dieser Kommandant hatte selbst eine Tochter, die nicht viel älter war als
das Mädchen. Aus scheinbar ”braven” Familienvätern wurden gemeine Bestien.
Ich habe mich oft gefragt: ”Warum sind sie so wahnsinnig, was haben wir
getan?” Ich verstehe nicht, wie jemand so entsetzlich böse sein kann. Einmal
hab ich miterlebt, wie ein Tschetnik seinem ehemaligen muslimischen
Schulkameraden mit dem Gewehrkolben das Gesicht zertrümmert hat. Oder wie
sie damals im Wald die sieben Männer, die sowieso schon am Ende waren,
niedergemetzelt haben – ich versteh das einfach nicht!
Auch in dieser Wohnung hatten wir viel
zu tun. Jeden Tag mußte ich mindestens zwei große Brote backen. Wenn ich in
der Küche nichts mehr zu tun hatte, setzte ich mich hin und häkelte
Hausschuhe. Früher tat ich das nie, aber in dieser schlimmen Zeit häkelte
ich ununterbrochen. Mein Gott, für alle Mädchen häkelte ich Hausschuhe - es
ist verrückt, heute habe ich keine Ahnung mehr vom Häkeln.
Diese letzten vier Monate in Foca waren
die schlimmsten. Oft wurden wir geschlagen, und wir wußten von einem Tag auf
den anderen nicht, wo wir hinkamen. Von einer Bande wurden wir an eine
andere ”verkauft”, von einem Ort zum anderen gebracht. Im Gesicht hatte ich
eine schwere Verletzung, an der ich heute noch leide, einen Jochbeinbruch,
den mir damals ein Tschetnik durch einen fürchterlichen Schlag zugefügt hat.
Diese Typen waren meistens betrunken,
sie tranken den Schnaps aus Kanistern und schossen manchmal wild um sich. In
den Wohnungen war es fürchterlich kalt, es gab keine Heizungen und die
Fensterscheiben waren kaputt. Es war der reinste Terror: Sie ließen uns
nicht schlafen und quälten uns. Das Essen war schrecklich, obwohl ich Hunger
hatte, konnte ich nichts essen. Im nachhinein frage ich mich manchmal, wie
ich das alles überleben konnte.
Einmal zwangen sie uns, nackt durch die
Stadt zu gehen. Es war Ende Jänner und wir haben die Kleider vor unsere
Körper gehalten, hinter uns die Tschetniks mit den Messern und der ständigen
Drohung, uns umzubringen. Wir zitterten vor Angst und Kälte, aber die Leute
auf der Straße haben gar nicht reagiert. Anscheinend war es ihnen recht, daß
wir umgebracht werden. Irgendwie haben wir auch das überlebt.
Menschlichkeit
mitten im Terror
In der Zwischenzeit hat mich der Mann,
der mir damals die Schokolade geschenkt hat, gesucht und durch Zufall auch
gefunden. Er meinte, er wolle mir helfen, aber ich glaubte es ihm einfach
nicht. Ich konnte niemandem mehr glauben. Ich sagte zu ihm: ”Willst du mich
vergewaltigen, dann tu es, aber laß mich in Ruhe.” Er tat es nicht, im
Gegenteil, er wiederholte, er wolle mir helfen, hier herauszukommen. Aber
erst müßte er jemanden finden, dem er vertrauen könne.
Später erfuhr ich, daß er damals
begann, meine Flucht vorzubereiten. Da in ganz Foca kein Benzin mehr zu
kriegen war, hat er beispielsweise seinen Bruder nach Montenegro geschickt.
Er selbst, auch das habe ich erst später mitbekommen, saß vor dem Krieg
wegen Einbruch und Diebstahl im Zentralgefängnis von Sarajevo. Aber der
Krieg hat ihn verändert. Nachdem man sich als Tschetnik ohnehin alles nehmen
konnte, hat ihn die Sache nicht mehr interessiert. Warum er mir aber
tatsächlich geholfen hat, verstehe ich bis heute nicht so recht.
Inzwischen war ich nicht mehr mit den
anderen Mädchen zusammen. Ein Tschetnik von der übelsten Sorte hatte mich
gekauft und mit sich genommen. Die Wohnung, in der ich bis zu meiner Flucht
lebte, hatte ursprünglich einer alten muslimischen Frau gehört, der
blutverschmierte Teppich am Balkon erinnerte an ihren gewaltsamen Tod.
Es war Anfang März, ich erinnere mich
noch genau, in der Wohnung war es eiskalt - es gab ja keinen elektrischen
Strom und keine Heizung. Deshalb legte ich mich schon am Nachmittag ins
Bett. Plötzlich kam der Tschetnik, der mich gekauft hatte, nach Hause, und
ich mußte sofort aufstehen und mich schön machen. Er sagte etwas von drei
Brüdern, die er mitgebracht hätte, mit denen wollte er noch ein bißchen
sitzen und trinken. Zuerst hatte ich fürchterliche Angst: Mein Gott, was
wird jetzt wieder passieren? Andererseits war mir damals schon alles
ziemlich egal. Ich wog nur mehr vierzig Kilo, ich war krank, alles tat mir
weh, und ich schleppte mich nur mit größter Mühe durch die Wohnung. Ich war
am Ende.
Die Männer, die hereinkamen, waren
freundlich. Erst jetzt erkannte ich den Mann wieder, der mir damals so
eindringlich versprochen hatte, mich herauszuholen. Er sagte: ”Schau, ich
hab dir jemanden mitgebracht.” Ich war sehr mißtrauisch, aber als ich mich
zu den Männern wandte, erkannte ich plötzlich meinen serbischen Nachbarn aus
meinem Heimatdorf. Ich war so fertig, ich hab die ganze Zeit geweint. Er
aber meinte: ”Du sollst nicht weinen, ich helfe dir.” Wir sind die ganze
Nacht zusammengesessen und haben miteinander gesprochen. Keiner von den
dreien hat mich angerührt, nur mein ”Hausherr”, der entsetzlich betrunken
war, hat immer wieder gelallt: ”Das ist mein Mädchen. Das ist mein Mädchen.
Die habe ich gekauft.” Er wollte mich auch zwingen, auf dem Tisch für sie zu
tanzen, aber einer der beiden anderen Männer hat gemeint: ”Sie tanzt heute
sicher nicht mehr.” Am nächsten Morgen schenkte mir einer von ihnen Brot und
Kekse und sagte: ”Mach dich bereit, wir kommen heute wieder und holen dich
ab. Ich verspreche es dir.”
Ich konnte ihm einfach nicht glauben.
Als sie gegangen waren, hab ich mich ins Bett gelegt und bin eingeschlafen.
Gegen drei Uhr nachmittag wache ich auf und durchs Fenster
sehe ich vor dem Haus viele Tschetniks stehen, darunter auch die Männer von
der letzten Nacht. Sie sind in einen Streit verwickelt, irgend jemand hat
die beiden offensichtlich verraten. Plötzlich stürmt ein Unbekannter ins
Zimmer und bedroht mich mit einem Messer. Hinter ihm sagt einer meiner
Befreier: ”Wenn du ihr weh tust, wirst du sehen, was mit dir passiert.” Der
Fremde entgegnet: ”Sie darf nicht weg, sie gehört dem Tschetnik, der sie
gekauft hat.“ Daraufhin der andere wieder: ”Sie ist kein Schwein, keine Kuh,
kein Schaf, wo kann man sie kaufen?“ Und zu mir gewandt: „Du nimmst deine
Sachen und gehst mit”. Wir gehen hinaus, draußen sind viele Leute, mein
Begleiter fordert mich auf, schneller zu gehen. Die Situation ist sehr
gefährlich. Eine serbische Frau schreit mich an, sie droht, mich eigenhändig
umzubringen, aber wir springen ins Auto und fahren los.
Wir fuhren über Gacko nach Montenegro
bis Titograd (heute: Podgorica). Mein serbischer Nachbar blieb bei mir, der
andere, mein eigentlicher Befreier, wünschte mir alles Gute und viel Glück
und verabschiedete sich in Titograd von uns. Ich solle ihm eine Flasche
Schnaps schicken, die würde er trinken und an mich denken. Ich habe ihm die
Flasche geschickt.
Von Titograd ging es quer durch Serbien
nach Subotica in der Vojvodina, direkt an der ungarischen Grenze. Mit einem
serbischen Begleiter an meiner Seite fühlte ich mich sicher. Von Subotica
aus habe ich meinem Bruder ein Telegramm nach Österreich geschickt, und er
kündigte ebenfalls telegrafisch seine Ankunft für den nächsten Morgen an.
Wir fuhren mit dem Taxi zur ungarischen Grenze, ich wartete im Auto. Es war
kalt, und wir hatten Hunger. Unser Geld war zu Ende. Wir hatten alles für
die Bahnkarten, das Telegramm und das Taxi ausgegeben. Was machen wir, wenn
mein Bruder nicht kommt? Er ist aber gekommen. Zuerst hab ich ihn gar nicht
so richtig erkannt: Er war so dick. Ich sprang aus dem Auto und lief auf ihn
zu. Ich habe so viel geweint. Er hat mein Telegramm an seinem Geburtstag
bekommen.
Wir kamen nach Steyr. Dort traf ich, nach fast einem Jahr,
meinen Vater wieder. Das war sehr schwer. Erst jetzt wurde mir langsam
wieder bewußt, was in der Zwischenzeit alles passiert war.
Ich hatte einen richtigen Zusammenbruch. Die anderen
unterhielten sich, redeten und lachten, aber ich war völlig fertig. Es war
wie ein Film, der an mir vorbeizog, ich bekam überhaupt nichts mit, ich
starrte nur vor mich hin. Dann weinte ich wieder stundenlang. Wenn ich ein
Auto von der Straße her hörte, bekam ich fürchterliche Angst und wollte
schreien. Einmal wurde ich ohnmächtig und fiel um. Mein Bruder glaubte
damals, ich sei tot. Es war sicher die Erschöpfung. Niemand konnte mir
helfen. Dazu kam, daß ich ja illegal im Land war, unangemeldet, ohne Arbeit,
ohne Geld. Gemeinsam mit meinem Vater und meiner Cousine wohnte ich bei
meinem Bruder und seiner Familie, wir teilten uns zu fünft einen kleinen
Raum. Es gab kein Wasser und später dann auch keinen Strom mehr, weil uns
der Besitzer hinaushaben wollte. Mein Vater und meine Cousine bekamen 1500
Schilling Flüchtlingsunterstützung, davon lebten wir und bezahlten das
Zimmer.
Eigentlich wollte ich wieder zurück
nach Bosnien. Alles war fremd, es war nicht meine Stadt, nicht meine Leute,
ich verstand die Sprache nicht, welchen Sinn hatte es, dazubleiben? Mir war
alles egal, ich wollte zurück zu meiner Mama, zu meinem Bruder. Ich konnte
nicht verstehen, daß sie tot waren.
Heute ist es anders. Ich will nicht
mehr daran denken, ich will leben. Ich habe acht Monate lang geweint, ich
kann nicht mehr.
Zufällig fand ich damals eine Annonce
in einer bosnischen Zeitung. Ein Mädchen, das ich aus der schlimmsten Zeit
in Bosnien kannte, war auf der Suche nach irgendwelchen Angehörigen. Ich
habe sie in Deutschland angerufen, wir haben lange miteinander gesprochen.
Sie erzählte mir von einer kleinen privaten Organisation, die den Mädchen
aus den serbischen Zwangsbordellen helfen wollte. Ich entschloß mich, mit
dieser Organisation Kontakt aufzunehmen und nach Deutschland zu gehen. Ich
glaubte, daß die mir helfen könnten, ich dachte an eine Wohnung, eine Arbeit
und an ein normales Leben. Es ging alles ganz schnell: Das Visum war kein
Problem, der Mann aus Deutschland kam und brachte mich ins Saarland, in die
Nähe der französischen Grenze.
Aber Deutschland war für mich eine
große Enttäuschung. Ich lebte zusammen mit einer anderen bosnischen Frau,
die zwei Kinder hatte, in einer Wohnung. Täglich mußte ich im Büro dieser
Hilfsorganisation Adressen schreiben, für Briefe, die ich nicht verstand und
die offensichtlich dazu verschickt wurden, um Geld für die verschiedenen
Aktivitäten der Organisation zu bekommen. Außerdem verlangte man von mir,
Interviews zu geben, für Zeitungen, fürs Radio, fürs Fernsehen. Überall
sollte ich meine schreckliche Geschichte erzählen. Der Sinn dieser Sache
bestand darin, durch diese Auftritte möglichst viele Spenden aufzutreiben.
Ich habe mich zum zweiten Mal
mißbraucht gefühlt. Die einzige, die mich verstand, war meine bosnische
Mitbewohnerin. Als ich zu meinem Chef sagte, daß ich meine Geschichte nicht
mehr überall erzählen wollte, beschimpfte er mich nur und sagte: ”Geh doch
wieder zurück, woher du gekommen bist”. Ich habe diesen Mann gehaßt.
Als die Frau, mit der ich
zusammenwohnte, wegging, um in Bosnien Frauen und Kindern aus den Lagern
helfen, habe ich begonnen, ernsthaft Deutsch zu lernen. Ich besuchte einen
Deutschkurs. Ich wollte nicht von irgendwelchen Dolmetschern abhängig sein,
ich habe ihnen nicht mehr vertraut. Langsam nahm ich mein Leben immer mehr
selbst in die Hand.
Die Angst ist geblieben
Ende Oktober 1993 kam ich wieder nach Steyr. Ich ging gleich
zur Polizei, um mich anzumelden. Die meinten aber, ich müßte weg. Da sagte
ich: ”Meine Familie ist da. Ich habe niemanden sonst, wohin soll ich gehen?”
Das hat sie nicht interessiert.
Gott sei Dank hat mir ein Bekannter
geholfen und mich bei ihm in Niederösterreich angemeldet. Gewohnt habe ich
aber bei meinem Vater und meiner Cousine in einem Zimmer in Steyr.
Meine Cousine hat dann bald geheiratet.
Mein Vater wollte nach dem Krieg unbedingt wieder nach Bosnien zurück, ich
habe ihn aber nicht weggelassen. Der Krieg und vor allem der Tod meiner
Mutter und meines Bruders haben ihn verändert. Er hat zu trinken aufgehört,
war oft sehr traurig und hat viel geweint. Ich traute ihm nicht zu, daß er
in diesem Land allein zurechtkommen würde. Hier in Österreich ist alles ganz
anders: Niemand will Papa und Mama bei sich haben. Bei uns ist die Familie
sehr wichtig.
Ich habe schon gespürt, daß Papa in
Steyr nie glücklich werden könnte, und so ist er schließlich doch
zurückgegangen. Ich habe alles mit ihm geteilt. Für das wenige Geld, das ich
hier bekam, habe ich ihm Kleider und andere Dinge geschickt. Ich wollte ihm
helfen und habe alles getan, damit er ein wenig glücklich war. Nach einiger
Zeit wollte er sogar wieder heiraten und begann, in Sarajevo eine kleine
Wohnung herzurichten. Doch im vergangenen Jahr ist er plötzlich an einem
Herzinfarkt gestorben. In Wirklichkeit hat er seine Lebensfreude nie wieder
zurückgewonnen.
Jetzt, nachdem auch Papa tot ist, habe
ich niemanden mehr in Bosnien. Ich will nicht mehr zurück und nach all dem,
was passiert ist, kann ich nicht mehr zurück. Ich möchte hier in Österreich
normal arbeiten und leben, aber ich habe immer noch Angst. Angst vor der
Polizei, vor den Behörden, Angst vor den Männern. Nach dem, was mir passiert
ist, habe ich kein Vertrauen mehr zu Männern. Ich habe die Männer so gehaßt.
Einmal war ich mit meinem Bruder und dem Mann meiner Schwester in einem
Gasthaus. Es gab Musik, und da kam einer, der wollte mit mir sprechen. Ich
dachte sofort, daß er mich schlagen würde, und ich sagte zu meinem Bruder:
”Bitte, bring ihn weg. Ich will nicht mit ihm sprechen.” Ich konnte einfach
nicht anders.
Vergangenes Jahr, nach dem Tod meines
Vaters, bin ich zur Caritas gegangen und habe ihnen meine ganze Geschichte
erzählt. Die haben sich sehr um mich bemüht und mir dann wirklich geholfen.
Seither habe ich eine schöne Wohnung und bin ein anerkannter
De-facto–Flüchtling.
Mittlerweile kenne ich viele Leute hier
in Steyr, auch Österreicher. Viele sind sehr freundlich und haben mir
geholfen. Mit den Behörden habe ich keine so guten Erfahrungen. Egal, wo ich
hinkam, überall hieß es: ”Das geht nicht.” Als ich beispielsweise am
Arbeitsamt die Papiere über meine Aussagen vor dem ”Haager Tribunal”
zeigte, meinte man, das interessiere sie nicht.
Trotzdem gefällt es mir hier. Steyr ist
nach Foca die zweite Stadt in meinem Leben. Auch hier gibt es zwei Flüsse,
die zusammenfließen, auch hier gibt es Berge. Meine Wurzeln bleiben aber in
Bosnien. Seit kurzem habe ich wieder einen Freund, er kommt aus Foca. Ich
könnte mir nicht vorstellen, daß er woanders herkäme.
-------------
Das Interview mit Sada Barlov wurde im
April und Mai 1998 in Steyr geführt. Name und persönliche Daten wurden
geändert.