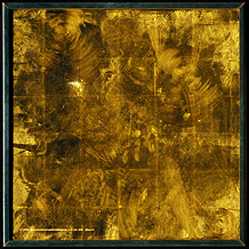1998 Fluchtspuren, Bukowina - Polen -Steyr
Ich stamme aus der Bukowina, genau
genommen aus der Südbukowina im heutigen Rumänien. Meine Eltern waren
Bauern. Das Dorf an den Ausläufern der Waldkarpaten, in dem sie eine - für
heutige Verhältnisse - kleine Landwirtschaft betrieben, hieß Bori und hatte
sicher nicht mehr als 250 Einwohner. Obwohl es ein paar Handwerker und ein
kleines Geschäft gab, war Bori ein reines Bauerndorf. Die Vorfahren aller
Dorfbewohner wurden dort zu Beginn des 19. Jahrhunderts angesiedelt und
stammten aus Seewiesen im Böhmerwald. Die ganze Gegend wurde unter Kaiserin
Maria Theresia von deutschsprachigen Österreichern besiedelt.1 Unser Dorf
wurde relativ spät, nämlich erst 1835 gegründet. Da die Gegend von Seewiesen
sehr karg war und die Landwirtschaften auf Grund der Erbteilung immer
kleiner wurden, haben sich die Auswanderer wahrscheinlich hier etwas
Besseres erwartet. So wie viele Burgenländer nach Amerika auswanderten, sind
halt viele Böhmerwälder damals in die Bukowina gegangen. Die Gegend war zwar
sehr hügelig, aber die Böden waren sehr fruchtbar, man konnte alles anbauen.
Wir haben Kühe gehabt und Getreide angebaut. Normalerweise hatten wir keine
Knechte oder Mägde, nur in der Anbauzeit im Frühjahr und zur Ernte hat mein
Vater Tagelöhner beschäftigt.
Bori war ein geschlossenes "deutsches"
Dorf. In der Umgebung, beziehungsweise in der ganzen Bukowina, gab es aber
ein richtiges Völkergemisch: Rumänen, Deutsche, Ruthenen, Juden und andere.
Gegen die Berge zu waren die Dörfer vor allem rumänisch, in der Stadt gab es
neben Deutschen und Rumänen auch Juden. Die Geschäfte beispielsweise waren
zum Großteil in jüdischem Besitz. Die Deutschen arbeiteten dort eher die
Handwerker, die Rumänen hatten zum Teil größere landwirtschaftliche
Betriebe. Wenn ich von Stadt rede, dann meine ich Gurahumora (heute: Gura
Humorului), nur ein paar Kilometer von Bori entfernt. In die Stadt kamen wir
am Sonntag, wenn wir in die Kirche gingen, oder zum Einkaufen. Wir haben
auch unsere Produkte am Markt verkauft. Für viele Sachen hatten wir unsere
fixen Abnehmer, zum Beispiel für die Milch. Wenn eine Kuh ein Kalb bekommen
hat, war aber mehr Milch da; dann hat die Mutter gesagt: "Wenn du mehr
verkaufst, gehört das Geld dir."
Unsere Hauptgeschäftspartner waren
eigentlich Juden. Nicht nur für die Milch, sondern auch für andere Produkte.
Im Herbst und Winter brachten wir den Juden Brennholz. Auch da hatten wir
schon unsere Stammkunden. Unser Verhältnis zu den Juden war gut, und wir
machten auch nur gute Erfahrungen mit ihnen. Wie gesagt, die Juden waren in
erster Linie Händler und Geschäftsleute und dadurch schon ein bißchen
wohlhabender als die anderen. Sie hielten auch sehr zusammen und halfen sich
gegenseitig immer wieder aus. Das war bei den Deutschen nicht üblich, und so
hatten manche schon Vorurteile. Ich kann mich noch gut daran erinnern, daß
die deutschen Kinder die Judenkinder wegen ihres Aussehens, den Locken und
den Hüten, oft sekkierten. In Gurahumora gab es auch eine Judengasse mit
einem Bethaus. Meine Tante wohnte in dieser Gasse; mein Cousin und ich
spielten manchmal mit jüdischen Kindern, wenn ich bei ihm zu Besuch war.
Warum unsere Familie nichts gegen Juden hatte, hing sicher damit zusammen,
daß mein Vater vor meiner Geburt fünfzehn Jahre in Amerika war und dort
viele Juden kennenlernte. Er hat uns erzählt, daß er öfter mit Juden, mit
denen er zusammenarbeitete, gebetet hat. Er selbst war ein sehr gläubiger
Katholik, respektierte aber alle anderen Religionen. Wahrscheinlich machten
ihn seine Erfahrungen in Amerika toleranter.
Er war übrigens nicht der einzige, der
damals wegging, einige aus der Gegend sind zum Geldverdienen nach Amerika
gefahren. Er machte dort alles mögliche, einmal arbeitete er sogar in einem
Rüstungsbetrieb. Der Mutter hat er regelmäßig Geld geschickt, und sie kaufte
damit Grund; so konnte sie die Wirtschaft vergrößern. Natürlich muß das eine
schwere Zeit für sie gewesen sein, der erste Weltkrieg begann, und die
Bukowina war ein schwer umkämpftes Gebiet. Nach dem Krieg starb dann auch
noch meine Schwester mit zwölf Jahren an Typhus. Das war wohl auch der
Grund, warum mein Vater bald danach, im Jahr 1927, zurückkam.
Im März 1929 bin ich dann auf die Welt
gekommen, zwei Jahre später meine Schwester und 1934 mein Bruder. Wir
wuchsen alle drei im Dorf auf, gingen dort auch in die Volksschule und
führten eigentlich ein sehr unbeschwertes Leben. Unsere Eltern spannten uns
auch nicht sehr zur Arbeit ein, nur am Abend mußten wir mit in den Stall. In
erster Linie ging es ums Zuschauen, um zu lernen, wie man die Stallarbeit
macht. Meistens spielten wir aber dann mit den Kälbern und hatten unseren
Spaß dabei. Der Vater nahm mich überallhin mit: zum Holzführen im Winter,
zum Abholen der geernteten Erdäpfel im Herbst. Erdäpfel waren das
Hauptnahrungsmittel bei uns. Es gab sie in den verschiedensten Variationen,
das kam wahrscheinlich aus der böhmischen Küche unserer Vorfahren. Typisch
für die Gegend war aber auch der Mais, der hier prächtig gedieh. Die Sommer
waren ziemlich heiß, die Winter sehr schneereich und kalt. Die Häuser im
Dorf waren eher klein und aus Holz, aber innen und außen so verputzt, daß
sie wie gemauert aussahen. Ich erinnere mich, daß der Pfarrer jedes Jahr ins
Dorf kam, um die Häuser zu weihen.
In der Schule hatten wir zwar einen
deutschen Lehrer, aber vom Gesetz her war Rumänisch die einzige
Unterrichtssprache. So richtig gelernt habe ich das Rumänische, ehrlich
gesagt, aber nie. Dafür gab es in den Ferien Deutschunterricht. Da kamen
dann immer die "Deutschländer", wie wir sagten. Das waren Studenten aus
Deutschland, Freiwillige, die geschickt wurden, um uns nicht nur Deutsch
beizubringen, sondern auch das "Deutschtum". So hatten wir praktisch nie
richtig Ferien, am Vormittag war Schule, am Nachmittag wurde geturnt und
gespielt. Diese Studenten wurden bei den Bauern untergebracht und kostfrei
gehalten. Sicher waren diese Leute sehr gern gesehen, auch wir beherbergten
gelegentlich einen von ihnen. Natürlich bekamen wir mit, was damals in
Deutschland passierte; diese "Sommerschule" war schließlich dazu da, uns zu
"guten" Deutschen zu erziehen.
„Heim ins Reich“
Im Frühjahr 1940 tauchte erstmals
deutsches Militär bei uns auf. Die Soldaten kamen in Bussen und wurden im
Vereinshaus oder bei den Bauern untergebracht, später sind dann
Militärfahrzeuge nachgekommen. Die Rumänen waren ja mit den Deutschen
verbündet2. Überall dort, wo deutsche Dörfer oder Familien waren, wurden
deutsche Soldaten hingeschickt. Das hat natürlich das Verhältnis zwischen
den einzelnen Volksgruppen in der Bukowina enorm verschlechtert. Viele Juden
sind nach Rußland oder anderswo hin ausgewandert. Die Beziehungen zwischen
Deutschen und Rumänen waren sehr angespannt. Vor allem unter den jungen
Burschen kam es immer wieder zu Raufereien und Übergriffen, die es vorher
nie gegeben hatte. Die Stimmung war sehr aufgeheizt, auch die Rumänen zogen
die Schraube an. Es gab zum Beispiel einen Erlaß, daß ab sofort in den
Geschäften nur mehr Rumänisch gesprochen werden durfte.
Das war natürlich Wasser auf die Mühlen
der deutschen Propaganda. Im Vereinshaus erzählten uns irgendwelche
Funktionäre, wie schön es einmal werden würde, wenn wir mit nach Deutschland
kämen. "Heim ins Reich" hieß damals die Parole. Alles, was wir hier
zurückließen, unser ganzes Vermögen, würden wir hundertprozentig wieder
zurückbekommen. Die meisten fielen natürlich darauf herein und meinten, es
wäre am besten zu gehen. Zu den Familien, die bleiben wollten, kam dann der
Stadtrat mit noch ein paar "höheren Herren"; dann wurden sie entsprechend
bearbeitet. Mein Vater, der ein sehr bekannter Mann war, wollte bleiben. Da
sagten sie zu ihm: "Geh weiter Leo, wegen der Kinder, fahr nach
Deutschland!" Natürlich ließ er sich auch überreden. Es entstand nämlich ein
großer Druck, dem sich niemand wirklich widersetzen konnte. Mein Vater war
aber überzeugt, daß wir nichts zurückbekommen würden. Es war, als ob er es
vorausgeahnt hätte. Im Endeffekt ging das ganze Dorf geschlossen weg,
niemand blieb. Bei aller Heimatverbundenheit, man konnte es sich einfach
nicht leisten zu bleiben, auch die Alten nicht. Viele waren natürlich von
Hitler begeistert, denen fiel das Weggehen wahrscheinlich leichter. Ich
erinnere mich, daß sich achtzehn Burschen aus unserem Dorf freiwillig zur
Wehrmacht meldeten, die waren wirklich begeistert. Mein Vater stand dem
Hitler von Anfang an sehr skeptisch gegenüber.
Das Weggehen selbst war eine sehr
traurige Geschichte. Da kann ich gar nicht viel darüber sagen, sonst kommen
mir wieder die Tränen. Für meine Eltern war es besonders schwer, aber es gab
halt wirklich keine andere Möglichkeit.
Auf jeden Hof kam dann eine Kommission,
die die Gebäude abmaß, den Wert von Grund und Boden schätzte und die Anzahl
der Haustiere vermerkte. Alles sollten wir zurückerstattet bekommen. Schon
Wochen vorher wurden der ganze Hausrat, Bettzeug und alles mögliche, in
Kisten verpackt. Der Vater zimmerte eine große Kiste, in der sogar der
geschnitzte Eichenkasten Platz fand. Eines Abends, es war Anfang
Dezember 1940, brachten sie uns mit Pferdefuhrwerken zum Zug.
Das Schlimmste war wirklich dieser
Abschied. Alle weinten, aber es war zu spät, es gab kein Zurück. Wir stiegen
in den Zug und fuhren los, ohne zu wissen, wohin, lediglich mit der
Versicherung, irgendwo wieder angesiedelt zu werden. Mein Onkel, der eine
Woche später nachkam, erzählte schreckliche Dinge: Die Kühe blieben
angeblich noch eine Woche in den Ställen, ohne gefüttert oder gemolken zu
werden, erst dann trieb man sie in die Stadt. Die Hunde und Katzen sollen
fürchterlich geschrien haben, es war das totale Chaos.
Im Zug bekam jeder seinen fixen Platz
zugeteilt. In der Nacht konnte ich nicht schlafen, durfte mich aber auch
nicht frei bewegen. Für mich war diese Fahrt eine Tortur. Am Morgen hielten
wir irgendwo an, alle mußten zum Waschen und Frühstücken aussteigen, ehe wir
die Fahrt fortsetzten. Drei Tage und zwei Nächte waren wir unterwegs, bis
wir endlich ankamen. Es stellte sich heraus, daß wir im steirischen
Trofaiach gelandet waren. Es war Dezember und auf den umliegenden Bergen lag
Schnee. Es war schon dunkel, sodaß zunächst niemand den schlechten Zustand
der Lagerbaracken realisierte. Aber als die Leute merkten, daß es hier am
Notwendigsten fehlte - beispielsweise gab es keine Betten, und alle mußten
zunächst auf dem Boden schlafen - war der Unmut schon sehr groß. Man
versprach uns "Milch und Honig", aber in Wirklichkeit standen uns zwei Jahre
hartes Lagerleben bevor. Als man uns dann noch sämtliche mitgebrachten
Lebensmittel abnahm, waren Wut und Enttäuschung fast am Überlaufen. Von
Begeisterung für den Führer war hier nichts mehr zu spüren.
Täglich kamen neue Leute an, zuletzt
waren es fast zweitausend Menschen, alle aus bukowinischen Dörfern. Die
Familien wurden in kleine Räume gepfercht, das Essen war dürftig, die
sanitären Verhältnisse katastrophal. Es gab beispielsweise keine
Einzeltoiletten, nur Klobaracken. Besonders schwer war es für die Alten,
alles Persönliche kam hier abhanden. Die Männer wurden gezwungen, bei den
umliegenden Bauern zu arbeiten, durch den Krieg waren auf den Höfen
vollwertige Arbeitskräfte Mangelware. Wir Kinder gingen am Vormittag
gemeinsam mit den Einheimischen im Ort in die Schule, am Nachmittag gab es
militärischen Drill durch Ausbildungsoffiziere der Wehrmacht. Neben strengem
Exerzieren mußten wir mit selbstgebastelten Holzgewehren Nahkampf
trainieren. Ich erinnere mich, ich war damals zwölf Jahre alt, als ich beim
3000 Meter-Lauf keine Luft mehr bekam und richtig niederbrach. Daraufhin
schikanierte mich der Ausbildner mit "Liegestützen" und mörderischem Robben.
Das alles war kein Spaß mehr. Bereits ab acht Jahren wurden die Jungen von
den Eltern getrennt und in eigenen Baracken zusammengefaßt. Neben der
militärischen Schulung gab es natürlich auch ideologischen Unterricht, wir
sollten offensichtlich zu besonders guten Reichsbürgern erzogen werden. Für
unsere einheimischen Schulkameraden waren wir aber nur "Lagerkinder", so wie
unsere Eltern halt nur "Flüchtlinge" waren.
Nach einem Jahr Trofaiach gaben viele
die Hoffnung auf eine baldige Verbesserung unserer Situation endgültig auf.
Den Versprechungen der deutschen Offiziere - "Ihr werdet angesiedelt, habt
Geduld, ihr müßt nur noch warten bis etwas frei wird" - glaubte niemand
mehr.
Im Herbst 1941 mußten wir Trofaiach
verlassen. Mit dem Zug ging es nach Branitz (Branica) im heutigen Polen,
unmittelbar an der tschechischen Grenze. Dort wurden alle Bewohner unseres
Dorfes in einem Lager in der Nähe des Frauenklosters untergebracht. Es war
etwas besser als das vorherige, auch das Essen war besser. Wir blieben ein
halbes Jahr, vom Herbst 1941 bis zum Frühjahr 1942. Auch dort arbeiteten die
Erwachsenen bei Bauern, und wir gingen in die Schule. Ich erinnere mich noch
genau an den Lehrer, einen alten pensionierten Offizier. Das erste, was er
in der Früh sagte, war: "Landkarte heraus! Wo steht das deutsche Militär?"
Damals waren die Deutschen ja noch auf dem Vormarsch. Die Propaganda war
unheimlich massiv. Immer wieder mußten wir in den großen Saal, der
Lagerführer drehte den Volksempfänger auf und dann ging es los. Es handelte
sich nicht nur darum, wie viele Schiffe versenkt oder Flugzeuge abgeschossen
worden waren, sondern auch um politische Propaganda, die vor allem gegen die
Juden ganz aggressiv war. Immer wieder wurde betont, wie sehr wir von den
Juden unterdrückt wurden und daß sie alle weg gehörten. Keiner von uns hat
sich da etwas zu sagen getraut, schon gar nicht im Saal, aber auch nicht in
den Wohnbaracken. Über Politik sprach man überhaupt nicht, das war zu
gefährlich, es hätte ja jemand mithören können. Mein Onkel dachte damals
irgendwann einmal zu "laut", da verriet ihn jemand, und er mußte sofort
einrücken. Die Jungen mußten sowieso einrücken, aber mein Onkel war schon
etwas älter und hatte drei Kinder. Solche Dinge prägten die Stimmung im
Lager.
Im Frühjahr 1942 mußten wir aus Branitz
weg. Wir kamen in ein drittes Lager, nach Gleiwitz (Gliwice) in
Oberschlesien, unweit von Kattowitz (Katowice). Das war das schlimmste
Lager. Alles war total heruntergekommen und schmutzig, die Räumlichkeiten
waren fürchterlich eng, das Essen unter jeder Kritik. Als wir hinkamen,
weigerten sich die Leute zuerst, dort einzuziehen - es blieb ihnen aber
nichts anderes übrig. Ich erinnere mich an einen Vorfall: Im Lager gab es
keine Milch, auch die Säuglinge bekamen keine. Ein paar jüngere Männer im
Lager sagten sich: "Jetzt passen wir einmal auf!" Sie bemerkten nämlich, daß
eine Krankenschwester jeden Abend mit einer Art Milchkanne von der
Küchenbaracke über den Hof zur Baracke des Lagerführers ging, in der auch
noch andere "Gehobene" wohnten. Der haben sie aufgelauert, weil sie schauen
wollten, was sie wirklich in ihrer Kanne hatte. Vor lauter Schreck leerte
sie ihre Milch sofort aus, und auch die Semmeln, die sie in der Schürze
versteckt hielt, fielen auf den Boden. Die Reaktion der Lagerleitung war,
daß die jungen Männer, die dieses Unrecht aufgedeckt hatten, unverzüglich an
die Front mußten. Die Wut unserer Leute war daraufhin unbeschreiblich. In
den Wohnbaracken wurde geflucht und geschimpft, aber niemand wagte,
öffentlich etwas dagegen zu sagen.
Die "Ansiedlung" in
Polen
Wir kamen frühmorgens an, ich erinnere mich an Pferdewägen mit polnischen Kutschern. Die deutschen Offiziere wiesen jedem Bauern einen Wagen zu, der sie zu dem jeweiligen Betrieb bringen sollte. Im Prinzip war alles genau eingeteilt. Es war aber so, daß sich die Männer aus unserem Dorf schon vorher erkundigt hatten, wo sie angesiedelt werden sollten. Sie hatten schon "Ausflüge" in die in Frage kommenden Gebiete unternommen und kannten daher die Verhältnisse ein bißchen. Als man meinem Vater einen Hof zuweisen wollte, sagte er, er ginge aus dem und dem Grund nicht hin. Immer wieder fand er eine Ausrede, einmal war ihm der Boden zu sandig, einmal zu naß, jedenfalls waren alle anderen schon angesiedelt, nur wir warteten noch im Lager. Nach einer Woche hieß es dann: "Jetzt müßt ihr hinaus!" Dann wurden auch wir weggebracht. Jeder Bauer bekam einen sogenannten Block zugeteilt. Ein Block bestand aus ungefähr sieben bis zehn Häusern mit der dazugehörigen Grundfläche. In den Häusern wohnten Polen, die ursprünglichen Besitzer dieser kleinen Landwirtschaften. Man hatte sie ihnen einfach weggenommen und uns gegeben. Nicht nur ihr Grund und Boden, auch ihre Tiere, vor allem Kühe, wurden uns zur Verfügung gestellt. Die einheimischen Männer und die jungen Frauen wurden zum Arbeiten in einer Bielitzer Fabrik gezwungen, die älteren Frauen blieben und halfen uns in der Landwirtschaft. So wurden aus den früheren Eigentümern Angestellte in ihren ehemals eigenen Betrieben!
Das Haus, das wir bekamen, war ganz
klein, dafür aber neu, mit einer sehr spartanischen Innenausstattung. Ich
erinnere mich noch gut an die deutsche Hakenkreuzfahne, die davor stand. Uns
war natürlich nicht wohl in unserer Haut, aber wir konnten auch nichts
dafür, daß wir da waren. Wohl wissend um das Unrecht, das den Polen
widerfahren war, hat mein Vater von Anfang an versucht, ein möglichst gutes
Verhältnis zu den polnischen Nachbarn herzustellen. Die alten Frauen, die
bei uns Kartoffel klaubten, hatten lange Röcke mit eingenähten Säcken, in
die sie Erdäpfel verschwinden ließen. Andere deckten einzelne Kartoffeln mit
Erde zu, um sie später wieder holen zu können. Von einem Aufpasser darauf
angesprochen, meinte mein Vater nur: "Laß sie doch!" und hat nichts dagegen
unternommen. Im Gegenteil, abends gab er jeder Frau ein Körberl voll
Erdäpfel mit nach Hause, ähnlich verfuhr er mit Milch und Getreide.
Die Polen standen dem Vater dadurch
eher positiv gegenüber, aber der Haß gegen die Deutschen im allgemeinen war
natürlich enorm. Immer wieder gab es Überfälle von polnischen Partisanen,
einmal wurde sogar eine Deutsche umgebracht. Zur Abschreckung haben dann die
Deutschen sechs gefangene polnische Offiziere im nächsten Dorf öffentlich
erhängt und ein paar Wochen später noch einmal acht. Dann erinnere ich mich
an eine polnische Familie, die in der Nacht abgeholt und nach Auschwitz
gebracht wurde. Kein Mensch wußte warum. In der Früh stand das Haus leer,
und die Türen waren mit Brettern vernagelt.
Es hieß übrigens öfter: "Der dort kommt
ins KZ" oder "Wenn du so weitermachst, kommst du nach Auschwitz". Auschwitz
wurde oft genannt, zumindest ab 1944. Jeder wußte, daß es dort ein Lager
gab, daß vor allem die Juden dort hingebracht wurden. Im 42er Jahr sah ich
in Bielitz noch Juden die Straßen kehren. Ich weiß auch, daß sie die Tramway
nicht benutzen durften und deshalb nur zu Fuß unterwegs waren. In Bielitz
gab es damals noch viele Juden, aber plötzlich waren sie alle weg. Wir
Kinder haben natürlich nicht gewußt, was in Auschwitz passierte, unsere
Eltern aber schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil immer wieder gesagt
wird: "Niemand hat etwas davon gewußt." Das gibt es doch gar nicht, da mußte
ja irgend etwas durchsickern.
Ich bin in Bukovice, so hieß das Dorf,
in dem wir lebten, noch in die Volksschule gegangen. Ursprünglich war es
eine polnische Schule, aber auch die wurde den Polen weggenommen. Polnische
Kinder konnten dann überhaupt nicht mehr in die Schule gehen. Daß ich,
obwohl ich gut lernte, nicht in eine höhere Schule in Bielitz gehen durfte,
habe ich unserem Schuldirektor, einem fanatischen SA-Mann, zu verdanken. Der
war auch Ortsbauernführer und in dieser Eigenschaft rief er einmal im Monat
alle Bauern des Dorfes am Sonntagvormittag zu einer Art Lagebesprechung
zusammen. Mein Vater war aber ein Mensch, der jeden Sonntag in die Kirche
ging. Weil es keine deutsche Kirche gab, besuchte er die polnische. Er ist
einfach von der Versammlung aufgestanden und zum Gottesdienst gelaufen. Der
Ortsbauernführer ist ihm natürlich draufgekommen und hat ihn zur Rede
gestellt. Sie haben ihm zwar nichts getan, zum Einrücken war er scheinbar
schon zu alt, dafür hat es der Schuldirektor mich spüren lassen. Nach der
Volksschule wurde mir die Landwirtschaftslehre zu Hause in Verbindung mit
der Landwirtschaftsschule in Bielitz verordnet. Das war schon alles
diktaturmäßig. Eigentlich wollte ich mit der Landwirtschaft nichts mehr zu
tun haben, wir wußten ja, daß uns der Betrieb nicht gehörte. Viel lieber
wäre ich Schlosser oder etwas ähnliches geworden.
Der Druck war immer spürbar. Ob es die
Bedrohung durch die Partisanen war oder die angespannte Alltagssituation,
wir wußten ganz genau, daß wir hier nicht bleiben konnten. Mein Vater hat
überhaupt nie damit gerechnet. Uns war immer klar: Wir gehören nicht
hierher.
Mit der Landwirtschaftsschule wurde es
Gott sei Dank sowieso nichts mehr. Die Russen kamen immer näher, und an den
Endsieg hatte schon lange niemand mehr geglaubt. Wir spürten alle, daß der
Krieg seinem Ende zuging. Erkennbar war das auch an den Flüchtlingskolonnen,
die von Warschau her kommend an uns vorbeizogen. Ende 1944 trieben die
Deutschen Tausende von russischen Kriegsgefangenen an uns vorbei. Es war
eine schier endlose Kolonne, immer sechs nebeneinander, und ich erinnere
mich, daß wir zwei Stunden standen und warteten, bis der Zug zu Ende war.
Eine Frau hat sich erbarmt und Brot herausgebracht, sofort haben sich ein
paar Russen darauf gestürzt. Die deutschen Bewacher haben sich aber
fürchterlich aufgeregt und mit ihren Gewehrkolben entsetzlich zugeschlagen.
Mein Vater begann, heimlich die Flucht
vorzubereiten. In der Scheune wurde ein Planenwagen zurechtgerichtet, im
Haus wurde zu packen begonnen. Anfang Jänner 45 hieß es dann: In zwei Tagen
müßt ihr weg. Schnell wurde noch ein Schwein geschlachtet, in einen
Wäschetrog gelegt und mit viel Heu zur Konservierung verpackt. Die Stimmung
der Leute, die schön langsam eine Routine im Abschiednehmen und Aufbrechen
entwickelt hatten, war zwiespältig. Einerseits war es fast ein Gefühl der
Erleichterung, weil die Situation war untragbar war, andererseits waren
Angst und Unsicherheit vor der Zukunft sehr groß. Niemand wußte, wohin es
gehen sollte.
Erst am Morgen des Fluchttages
erhielten wir von deutschen Militärs schriftliche Anweisungen über den Ort,
den wir bis zum Abend zu erreichen hatten. Wir haben immer erst in der Früh
erfahren, wo wir am Abend sein sollten. Für 10 Uhr hatte ich eine
Einberufung zum Volkssturm nach Czierk, um 8 Uhr fuhren wir aber schon weg.
Für meinen Vater gab es keine Diskussion: "Du fährst mit!"
Drei oder vier Dörfer bildeten zusammen
einen großen Treck, doch gleich am Anfang wurde eines unserer beiden Pferde
krank und wir blieben zurück. Zwei Tage mußten wir warten. Nun waren wir mit
drei Wägen allein unterwegs: im ersten Wagen meine Eltern, meine beiden
Geschwister und ich, im zweiten und dritten Wagen meine Tanten mit ihren
jeweils noch sehr kleinen Kindern. Beide hatten ihre Männer an der Front und
waren deshalb mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Zu allem Überfluß
wurde auch noch mein Vater krank, er hatte gefrorenes Brot gegessen und
konnte wegen schwerer Krämpfe den Wagen tagelang nicht verlassen. Mit meinen
fünfzehn Jahren war ich also der Wagenführer, was keine leichte Aufgabe war.
Oft kamen wir mit unseren schweren Wägen irgendwelche Berge nicht hinauf,
also mußten wir alle beim Umspannen mithelfen. Das hieß, alle Pferde an
einen Wagen spannen, den Berg hinauf, abspannen, mit den Pferden zurück, mit
dem nächsten Wagen den Berg hinauf und so weiter. Manchmal erreichten wir
daher unsere vorgegebenen Etappenziele nicht, was bedeutete, daß wir nichts
mehr zu essen bekamen. Das mitgenommene geschlachtete Schwein konnten wir
nicht essen, da es keine Kochmöglichkeit gab. Es war ein sehr kalter
Winter, und ich hatte drei Hosen übereinander angezogen. Dazu Vaters
Sonntagsschuhe, mit etlichen Socken darunter und die Lederhandschuhe, die er
aus Amerika mitgebracht hatte. Wir durchquerten die Tschechei (dort hatten
wir teilweise militärischen Geleitschutz) und erreichten bei Retz die
österreichische Grenze. Immer wieder kamen uns Militärfahrzeuge, die
offensichtlich in Richtung Front unterwegs waren, entgegen und auch in
unserer Richtung war reger Verkehr. Meine Mutter und ich gingen die gesamte
Stecke zu Fuß, so war uns warm und gleichzeitig schonten wir die Pferde. In
Enns verbrachten wir einige Tage, ehe wir nach Steyr weiterdirigiert wurden.
Die Steyrer wunderten sich über unsere schweren Wägen: "Wie kommt ihr denn
da über den Schnallenberg hinunter?" Wir schafften es aber, und standen kurz
darauf auf dem Stadtplatz.
Als wir Mitte März 1945 in Steyr
ankamen, waren wir bereits seit über zwei Monaten unterwegs. Nachdem sich
mein Vater bei den Behörden gemeldet hatte, wurden wir zunächst ins Stift
Gleink geschickt. Im dortigen Theatersaal konnten wir und andere Flüchtlinge
aus allen möglichen Gegenden übernachten, bis wir auf die verschiedenen
Bauern in der Umgebung verteilt wurden. Die Aufnahme in Steyr war nicht
schlecht, natürlich war man nicht begeistert, die Zeiten waren schwer, und
wir waren halt doch nur Flüchtlinge. Meine Familie kam zu einem Bauern am
Stadtrand. Der Vater wurde zur Arbeit im Wald abkommandiert. Meine Mutter
half im Kuhstall beim Melken, und auch ich wurde zur Arbeit eingeteilt.
Später durfte ich zu den Pferden und wurde "Roßknecht".
Anfang Mai kamen die Amerikaner3.
Ich erinnere mich, daß ich mit meiner Schwester in die Stadt gehen wollte,
als uns jede Menge Jeeps entgegenkamen. Ich erkannte an den vielen Antennen,
daß es amerikanische Fahrzeuge sein mußten. Wir hatten Glück, denn fast
wären wir in einen Schußwechsel geraten, den sich die Amerikaner mit
abziehenden deutschen Verbänden lieferten. Eine kleine Böschung, hinter der
wir in Deckung gingen, hat uns gerettet.
In der Besatzungszeit hat es dem Vater
geholfen, daß er früher einmal in Amerika war, dadurch konnte er sich mit
den Soldaten ganz gut verständigen.
Drei Jahre war ich beim Bauern. Ich war
nicht sehr zufrieden. Eigentlich wollte ich immer weg, irgend etwas anderes
lernen, ich schaffte es aber nicht. Außerdem empfand ich es als ungerecht,
daß ich, obwohl ich vier Pferde zu betreuen hatte, genau die Hälfte von dem
bekam, was die anderen Knechte für zwei kriegten. Als ich den Bauern darauf
ansprach, meinte er: "Für dich ist das genug." Das hat sehr weh getan. Da
begann ich, in meiner Freizeit Bekannten beim Hausbauen zu helfen, und so
gelang es mir, innerhalb kurzer Zeit eine fixe Anstellung bei einer Baufirma
zu finden. Dort habe ich es dann auch bis zum Platzmeister gebracht und bin
bis zu meiner Pensionierung geblieben. Wir zogen vom Bauernhof weg. Meine
Tante überließ uns eines ihrer beiden Zimmer, in das wir alle fünf einzogen.
1952 haben wir gemeinsam einen Grund gekauft und schön langsam zu bauen
begonnen, ohne jede Unterstützung, nur mit dem bißchen Geld, das mein Vater
und ich damals verdienten. Das Haus war schon fertig, als ich meine Frau
kennengelernt habe. Auch sie war mit ihrer Mutter vor Kriegsende geflüchtet
und kam aus einem deutschsprachigen Dorf im ehemaligen Jugoslawien. 1958
haben wir geheiratet, und im Laufe der Zeit drei Kinder bekommen.
Für mich ist Steyr zur zweiten Heimat
geworden, obwohl mir die Jugendzeit abgeht. Ich denke oft an die Zeit in der
Bukowina, an meine ehemalige Heimat, obwohl ich heute froh bin, hier zu
sein. Die Bukowina war halt meine erste Heimat! Ich war im Laufe der Zeit
öfter in Rumänien und auch in unserem Dorf Bori. Es hat sich nicht viel
geändert, es sieht noch genauso aus wie damals. Sogar mein Elternhaus steht
noch, aber ich weiß, es gehört nicht mir.
Für meine Eltern war es schwieriger,
hier in Steyr Fuß zu fassen, vor allem meine Mutter hat gelitten. Im Garten
unseres kleinen Hauses haben sie mit zwei Ziegen und zwei Schweinen so eine
Art Mini-Landwirtschaft betrieben. Ein Schwein war für uns, das andere wurde
verkauft. Ihre Lebensstütze war die Religion, von Hitler haben sie sich
betrogen gefühlt. Rückblickend gesehen ist ihm nicht nur unser Dorf, sondern
die ganze Bukowina mit allen Deutschen auf dem Leim gegangen. Besonders bei
meinen Eltern ist eine große Enttäuschung, eine große Trauer
zurückgeblieben. Sie sagten immer, am schlimmsten wäre das Packen gewesen.
Damit meinten sie wahrscheinlich das ständige Abschiednehmen. Sie wollten
auch nie wieder in die Bukowina fahren. Die Angst, daß das Bild, das sie von
ihrer Heimat hatten, zerstört werden könnte, war zu groß.
Vor fünf Jahren ist meine Frau
gestorben, jetzt lebe ich allein hier. Es reizt mich nicht mehr,
wegzufahren, groß Urlaub zu machen, auch meine Frau wollte das nie. In
meiner Jugend bin ich gezwungenermaßen genug herumgekommen, für mich ist es
heute gut, zu bleiben.
Das Interview mit Gregor Brandl wurde
in Steyr im Juni 1998 geführt.
Anmerkungen:
1
Als die Bukowina, das “Buchenland”, 1774 dem österreichischen
Habsburgerreich unter Maria Theresia angegliedert wurde, war es durch
kriegerische Auseinandersetzungen entvölkert. Die österreichische Verwaltung
(1775-1918) bemühte sich um eine Neuansiedlung. Deutsch war die Amtssprache,
katholisch die Staatsreligion. Neben Deutschen lebten Rumänen, Ukrainer,
Polen, Slowaken, Armenier, Russen, Lippowaner, Magyaren und Juden in der
Bukowina. Nach dem 1. Weltkrieg fiel sie an Rumänien. Ende Juni 1940 wurde
aufgrund des Hitler-Stalin-Geheimprotokolls die Nordbukowina mit
Bessarabien an die Sowjetunion abgetreten. Die Folge war die Umsiedlung der
Deutschsprachigen aus der Nordbukowina und anschließend auch aus der
Südbukowina nach Deutschland. Nachdem Rumänien an der Seite Deutschlands in
den Krieg gegen die UdSSR eintrat, holte es sich die Nordbukowina wieder
zurück, sie fiel aber nach 1945 wieder an die Sowjetunion.
2
1940 nach der Abdankung Carols II, der 1938 eine Königsdiktatur errichtet
hatte, folgte sein Sohn Michael I. auf den Thron. Ion Antonescu wurde
Staatsführer mit diktatorischen Vollmachten und führte Rumänien an der Seite
Hitler-Deutschlands in den Krieg gegen die Sowjetunion.
3
Am 5. Mai 1945, um 10 Uhr vormittag, wurde Steyr von den Amerikanern
befreit.
Literatur:
Manfred Scheuch, Atlas zur
Zeitgeschichte. Europa im 20. Jahrhundert, Wien 1992.
Rüdiger Dingemann, Westermann Lexikon.
Krisenherde der Welt. Konflikte und Kriege seit 1945, Braunschweig 1996.
W. Benz, H. Graml, H. Weiß,
Enzyklopädie des Nationalsozialismus, München 21998.
Manfred Brandl, Neue Geschichte von
Steyr. Vom Biedermeier bis Heute, Steyr 1980.